Operation gelungen, Patient tot: Noch vor etwas mehr als 150 Jahren starb die Hälfte aller Frischoperierten. Keimfreiheit gibt es in der Medizin erst seit gut 150 Jahren.
Bakterien-Biester
Der medizinische Fortschritt ging im 19. Jahrhundert rasend schnell von statten. Neue Erkenntnisse überholten alte Traditionen und brachten innovative Operationsmethoden mit sich. Die größte Gefahr blieben Wundbrände und Wundinfektionen, die nach dem Eingriff drohten. Der schottische Chirurg Joseph Lister (1827-1912) war einer der ersten, der den Wundkeimen den Kampf ansagte und Regeln für das Operieren entwickelte, die Infektionen verhindern sollten – und das zu einer Zeit, in der noch höchst umstritten war, ob diese überhaupt durch Bakterien verursacht werden. So sagte wohl John Hughes Bennett (1812-1875), ein Gegner Listers: „Wo sind diese kleinen Biester? Zeigen Sie sie uns, und wir werden daran glauben. Hat sie bisher schon irgendwer gesehen?“.
Voll vernebelt
Der „Vater der antiseptischen Chirurgie“ experimentierte in den 1860er Jahren mit Phenol, das auch als Karbolsäure bekannt ist. Ursprünglich wurde Phenol beispielsweise in Paris zur Geruchsbekämpfung von Abwässern und der Kanalisation eingesetzt. Lister zweckentfremdete den Stoff, indem er Wundverbände in Phenol tränkte. Später begann er, eine Phenollösung über dem Operationsfeld in einem feinen Nebel zu versprühen, so dass die Hände der Ärzte, die Instrumente und auch die Wunde mit einem desinfizierenden Film überzogen wurden.
Keine Chance für Bakterien
Phenol war der Stoff, der Leben rettete: Dank ihm wurden Bakterien auf der Wunde und im Verband abgetötet, neue Keime konnten sich so nicht verbreiten und die Wundheilung verlief ohne Komplikationen. Der immense Erfolg Listers – immerhin sank die Sterblichkeitsrate durch Infektionen bei seinen Amputationspatienten von über 45 auf 15 Prozent – sprach sich herum. In Frankreich griff der Chirurg Just Lucas-Championnière (1843-1913) Listers Ideen auf und entwickelte eigene Apparaturen zum Zerstäuben von Karbol und anderen Antiseptika, wie beispielsweise der nach ihm benannte Zerstäuber. Dennoch bargen die Karbolnebel auch Gefahren für die Gesundheit, wie etwa Schwellungen und Verätzungen der Haut. Zudem stellte sich ein anderes Vorgehen als wirksamer gegen die Erreger heraus, selbst Lister wandte sich um 1890 vom Karbolspray ab: Ab den späten 1880er Jahren begannen Chirurgen, alle Instrumente und Materialien, die mit der Operationswunde in Berührung kamen, von vorneherein durch heißen Wasserdampf keimfrei zu machen, auch die Kleidung. Lister etwa hatte noch im Straßenanzug operiert.
Antibakteriell heilen
In der Wundbehandlung kamen die Zerstäuber allerdings noch länger zum Einsatz. Der vorliegende Zerstäuber, der zwischen 1900 und 1925 hergestellt wurde, besteht aus einem Spiritusbrenner, einem Wasserkessel, einer verstellbaren Düse, die mit dem Kessel verbunden ist, einem Glasgefäß zur Aufnahme des Antiseptikums sowie einem Tragegriff aus Holz. Bei dem Exponat, das im TECHNOSEUM zu sehen ist, fehlt der Gummischlauch, der eigentlich von der Düse in das Glasgefäß mit dem Antiseptikum führt. Das Funktionsprinzip ist das Folgende: Im Kessel wird Wasser zum Kochen gebracht, der Wasserdampf strömt durch die Düse und erzeugt dabei einen Unterdruck, durch den das Antiseptikum angesaugt und anschließend zusammen mit dem Wasserdampf versprüht wird. Einfach, aber so wirksam, dass Ärzte Zerstäuber dieses Typs noch in den 1920er Jahren zur Wundbehandlung einsetzten.
Wo im TECHNOSEUM? In der Dauerausstellung auf der Ebene B im Bereich der Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts.



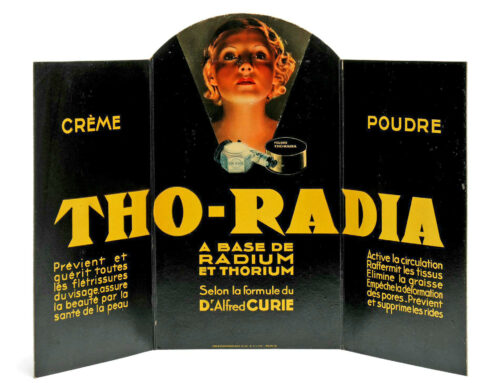


Hinterlasse einen Kommentar